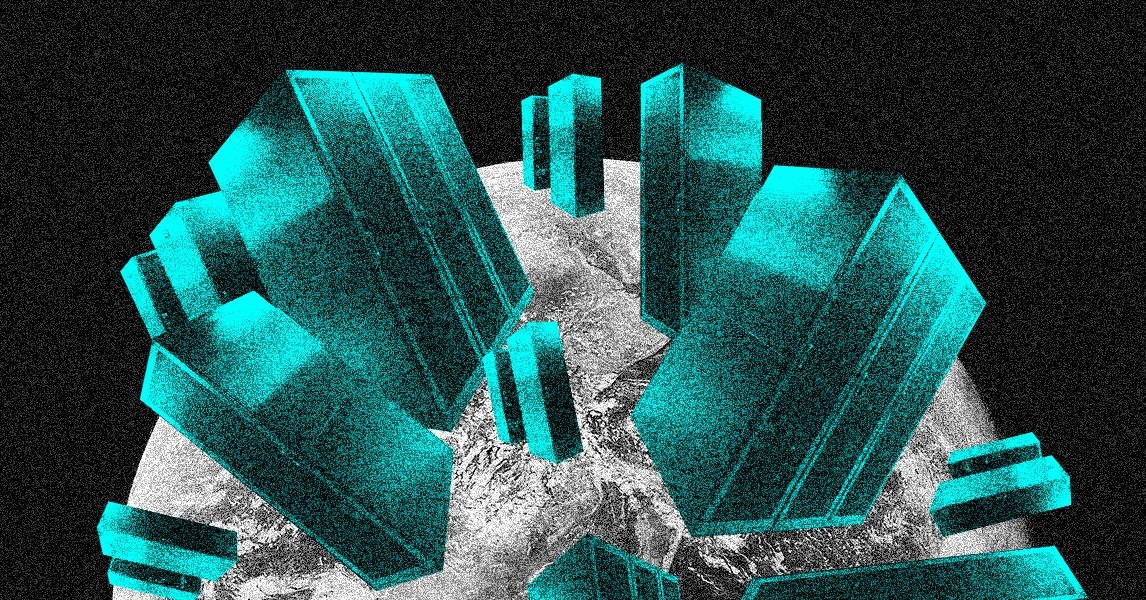ERKLÄRT - Darm und Hirn hängen zusammen – und diese Verbindung können wir nutzen

Welche Informationen der Darm ans Hirn sendet, wie das Gehirn für Durchfall und Magenschmerzen sorgt und wie wir mehr Wohlbefinden in die Darm-Hirn-Achse bringen.
Adrian Ritter

Illustration Simon Tanner / NZZ
Leserfrage: Wie sind Darm und Gehirn miteinander verbunden? Kann ich meine Psyche durch die Ernährung beeinflussen?
NZZ.ch benötigt JavaScript für wichtige Funktionen. Ihr Browser oder Adblocker verhindert dies momentan.
Bitte passen Sie die Einstellungen an.
Der Darm verdaut, und das Hirn denkt? So einfach ist es nicht. Die beiden Organe in unserem Kopf und Bauch stehen ständig im Austausch miteinander. Das Gehirn will wissen, was im Körper und in unserer Umgebung geschieht. Nicht nur die Sinnesorgane liefern dem Hirn wertvolle Informationen, sondern auch der Darm. Etwa darüber, ob und was wir essen. Meldet der Darm beispielsweise, dass wir gerade mit Essen beschäftigt sind, bedeutet das für das Gehirn, dass offensichtlich keine Gefahr droht und wir entspannen können.
In der Rubrik «Wohl & Sein antwortet» greifen wir Fragen aus der Leserschaft rund um Gesundheit und Ernährung auf. Schreiben Sie uns an [email protected].
Umgekehrt kann das Gehirn den Darm anweisen, die Verdauung zu stoppen, falls wir gestresst sind. Denn aus der Sicht des Gehirns ist es in diesem Fall sinnvoll, die Energie nicht für die Verdauung zu verwenden – vielleicht droht ja bald noch grössere Gefahr. Wird die Verdauung gestoppt, kann das individuell unterschiedliche Folgen haben – Durchfall oder Verstopfung ist möglich.
Vier Wege der KommunikationDer Grossteil der Kommunikation zwischen Darm und Hirn fliesst von unten nach oben – das Hirn als Dirigent des Orchesters unserer Organe braucht mehr Information als der Befehlsempfänger Darm.
Wie aber findet der Informationsaustausch statt? Er geschieht über vier Kanäle. Erstens sind die beiden Organe durch einen der längsten Nerven unseres Körpers verbunden – den Vagus, den Hauptnerv des parasympathischen Systems. Der Darm ist nämlich ebenfalls ein Nervenzentrum – das sogenannte enterische Nervenzentrum. Die Dichte an Nervenzellen im Darm ist so gross, dass man manchmal auch vom «Bauchhirn» spricht. Das ist allerdings etwas übertrieben. «Eigene kognitive Leistungen wie Gedanken oder Gefühle kann der Darm nicht produzieren», sagt Undine Lang. Sie leitet die Klinik für Erwachsene und die Privatklinik der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel und forscht unter anderem zum Zusammenspiel von Darm und Psyche.
Die Vorstellung von einem «Bauchgefühl» ist allerdings nicht abwegig. Denn Darm wie Hirn produzieren auch Hormone als zweiten Weg der Kommunikation. Der Darm kann über solche Hormone auch Angst im Hirn erzeugen. Evolutionär war das vermutlich sinnvoll, um uns etwa vor dem Hungertod, Infektionen oder einer Vergiftung zu schützen. Umgekehrt produziert das Gehirn unter anderem Hormone, welche die Darmbewegung beeinflussen. Das Resultat können stressbedingter Durchfall oder Magenschmerzen sein.
Als dritter Kommunikationsweg kommt ein weiterer Akteur ins Spiel: das Mikrobiom des Darms. Die Gemeinschaft der Darmmikroben stellt eigene Stoffwechselprodukte her, die ebenfalls als Botenstoffe zwischen Darm und Hirn dienen.
Viertens kommunizieren Darm und Hirn über das Immunsystem. Ein grosser Teil unserer Immunzellen sitzt nämlich im Darm. Das ist sinnvoll, denn mit unserer Ernährung gelangen auch viele Bakterien und andere potenzielle Krankheitserreger in unseren Körper. Diese gilt es mit einer Immunabwehr direkt vor Ort in Schach zu halten. Das Immunsystem im Darm wiederum wird sowohl vom Gehirn wie auch vom Mikrobiom beeinflusst und gibt diesen auch Rückmeldung.
Beim Darm oder Hirn ansetzenDarm, Hirn, Mikrobiom und Immunsystem stehen somit in einem ständigen Wechselspiel. «Viele dieser Wirkweisen kennen wir noch nicht gut», sagt Lang. Klar ist aber: Es gibt zahlreiche Ansatzpunkte, wie sich die Darm-Hirn-Achse beeinflussen lässt. Dabei können wir beim Darm oder Hirn ansetzen.
Beim Darm heisst dieser Ansatzpunkt hauptsächlich: Ernährung. Gewisse Inhaltsstoffe der Nahrung können über die Blutbahn direkt die Blut-Hirn-Schranke überwinden und sich auf das Hirn auswirken. Schokolade etwa sorgt für einen Dopaminschub im Hirn, was das Belohnungszentrum aktiviert und für Glücksgefühle sorgt.
Vertiefen Sie Ihr Wissen über Ernährung, Gesundheit und Psychologie mit unserem Newsletter «Wohl & Sein», der jeden Donnerstag in Ihrem Posteingang landet.
Der indirekte Weg, um über Nahrung das Gehirn zu beeinflussen, führt über das Mikrobiom. Was wir essen, bestimmt mit, wie unser Mikrobiom im Darm beschaffen ist. Auch hier sind längst nicht alle Zusammenhänge klar. Aber: Eine gesunde Ernährung fördert ein vielfältiges Mikrobiom, was gemäss heutigem Wissensstand vorteilhaft ist, um gesund zu bleiben.
«Wir wissen heute, dass Menschen, die sich an den Empfehlungen für eine gesunde Ernährung orientieren, seltener an Depressionen erkranken», sagt Lang. Eine Studie an den Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel zeigte zudem, dass Probiotika das Mikrobiom bereichern und ergänzend zu Medikamenten und Psychotherapie helfen, Depressionen zu lindern.
Und wie lässt sich die Darm-Hirn-Achse vom Kopf her beeinflussen? Hier bieten sich Entspannungstechniken, Yoga und Meditation, aber auch Psychotherapie an. Zunehmend populär ist die Vagnusnervstimulation. Dazu finden sich im Internet Übungen, um etwa mittels Selbstmassage den Nerv zu aktivieren. Es fehlt allerdings weitgehend an Studien, die untersuchen, wie wirksam dies ist.
Fachleute nutzen die Vagusnervstimulation, um epileptischen Anfällen vorzubeugen oder um therapieresistente Depressionen zu lindern. Dabei werden Stimulatoren unter die Haut implantiert. «Grundsätzlich lässt sich mit körperlichen und psychologischen Methoden über die Darm-Hirn-Achse sowohl die Gefühlswelt beeinflussen wie auch das Immunsystem stärken», sagt die Psychiaterin Lang. Und zwar nachhaltiger als mit Schokolade.
Sie haben auch eine Frage rund um Ernährung und Gesundheit? Schreiben Sie uns an [email protected].
nzz.ch